
Gedenkstätte Point Alpha
Haus auf der Grenze
Platz der Deutschen Einheit 1
36419 Geisa
Google Maps
US Camp
Hummelsberg 1
36169 Rasdorf
Google Maps
Anmeldung & Information
Gedenkstätte Point Alpha
Telefon: 0 66 51 / 91 90 30
Telefax: 0 66 51 / 91 90 31
E-Mail: service@pointalpha.com
Point Alpha Stiftung
Schlossplatz 4
36419 Geisa
Telefon: 03 69 67 / 59 64 20
Telefax: 03 69 67 / 59 64 26
E-Mail: stiftung@pointalpha.com
Google Maps
© 2021 Point Alpha Stiftung | gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
Close Menu
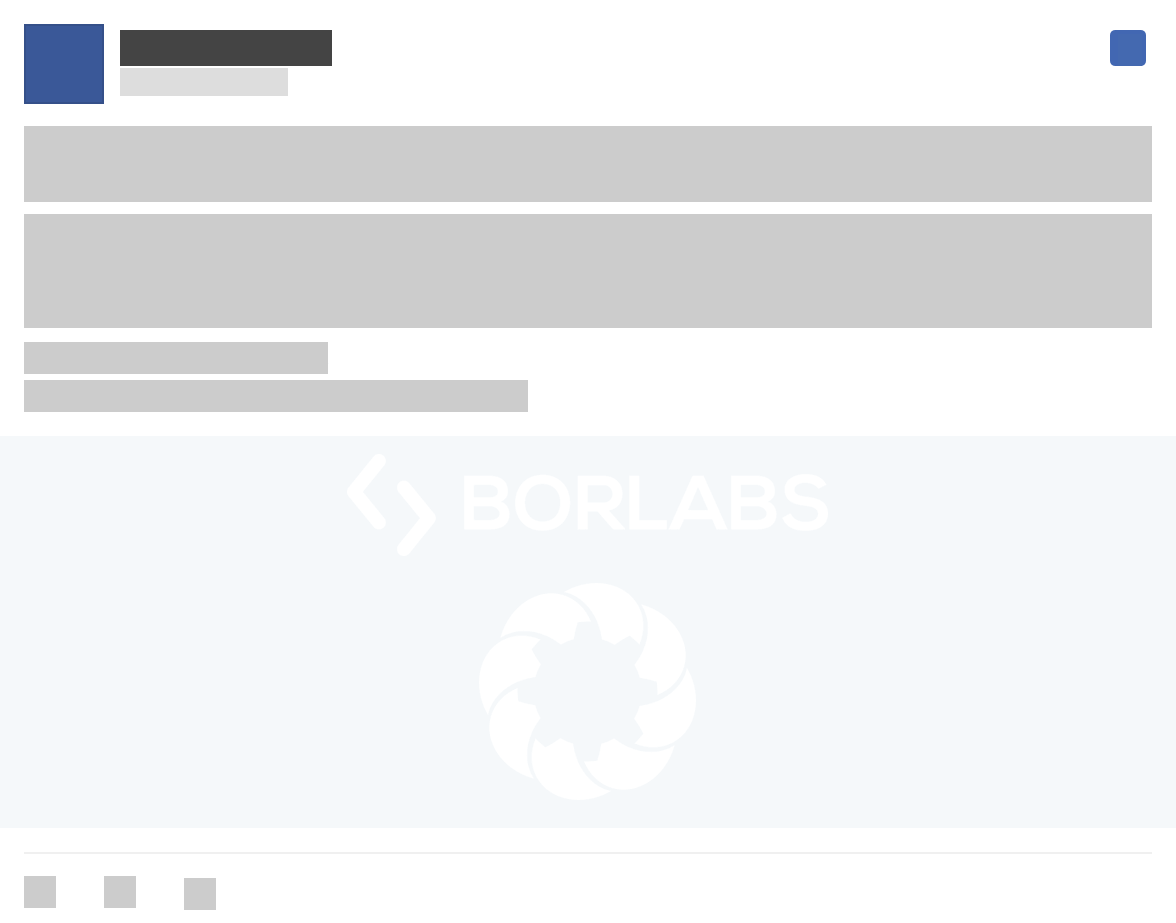
Point Alpha @facebook
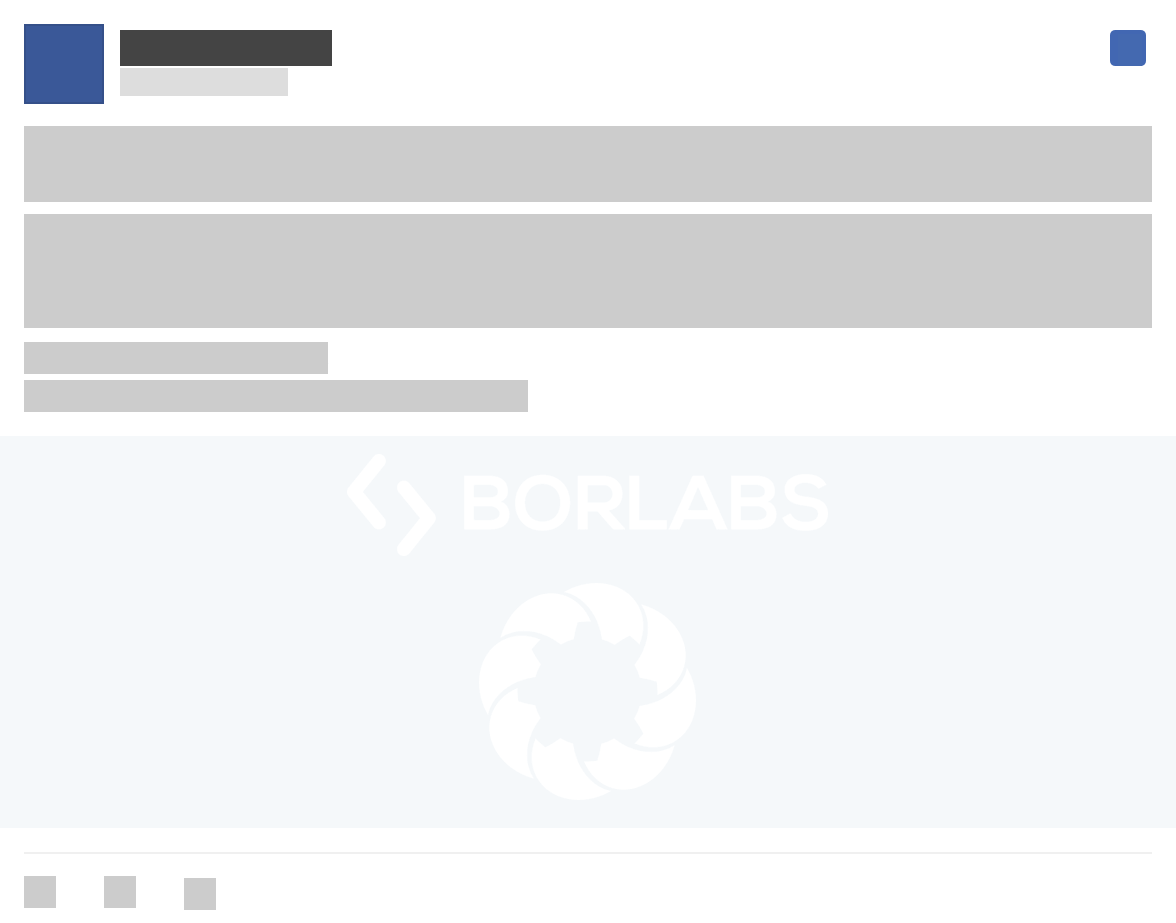
By loading the post, you agree to Facebook's privacy policy.
Learn more

